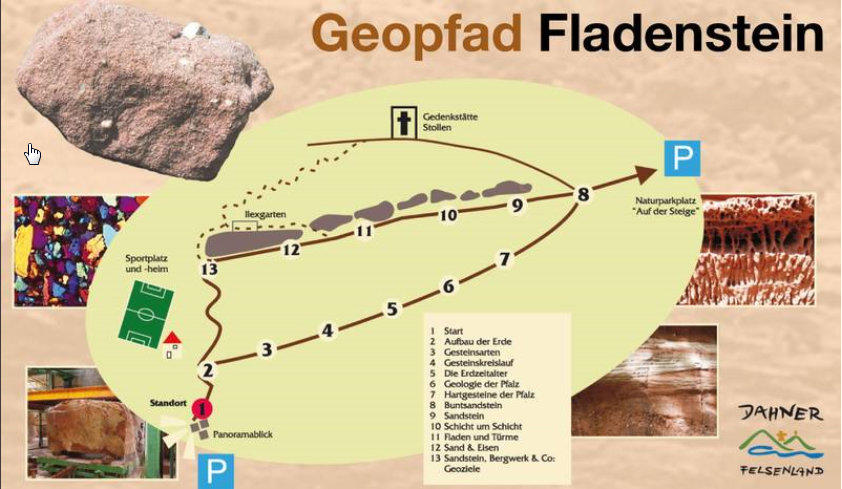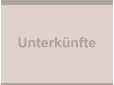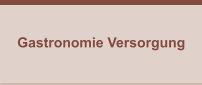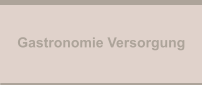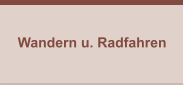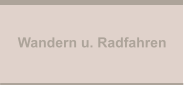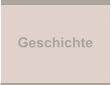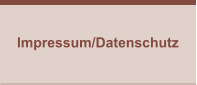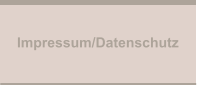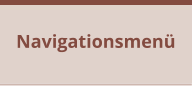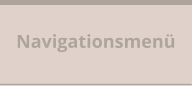Geologie zum Anfassen
Die Fladensteine gehören zu den bekanntesten Sandsteinmassiven des Pfälzer Waldes. Entstanden als ein über 400 m
langes, zusammenhängendes Felsmassiv, bildeten sich durch Bewegungen und Verwitterungen in der Erdkruste,
Klüfte zwischen den Steinen. Der größte der im Volksmund als “Sieben-Brüder” bezeichneten Sandsteintürme, misst
52m Wandhöhe.
Rund um das Felsmassiv der Fladensteine bei Bundenthal führt der Geopfad in die Zeit vor 250 Millionen Jahren und
noch weiter zurück in die Erdgeschichte. Von der Entstehung der Gesteine, über deren einheimische Vorkommen bis
hin zu ihrer Nutzung als unentbehrliche Rohstoffe finden sich anschaulich präsentierte Infos auf dem etwa
einstündigen Rundweg.
Start/Ziel: Bundenthal am Sportplatz.
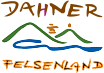

Bundenthal Touristik e.V. - 76891 Bundenthal -
Rechtenbacher Str. 29
Der Geopfad, rund um das Felsmassiv der Fladensteine führt in die Zeit vor rund 250 Millionen Jahren zurück.
Schautafeln informieren auf dem etwa einstündigen Rundweg über:
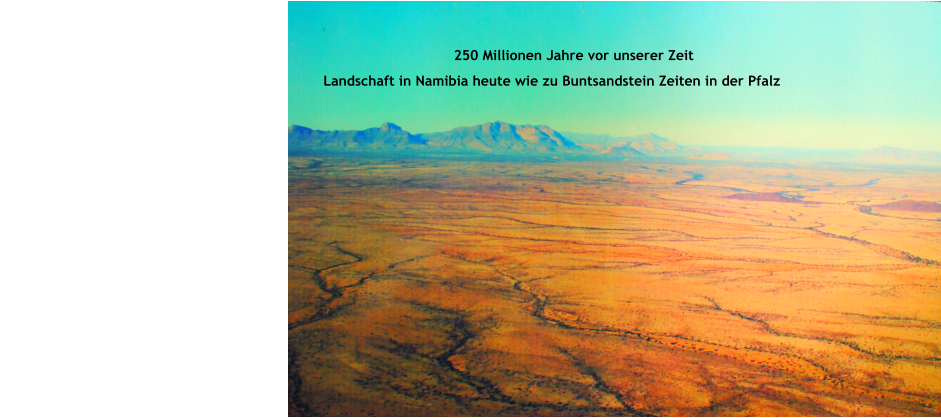
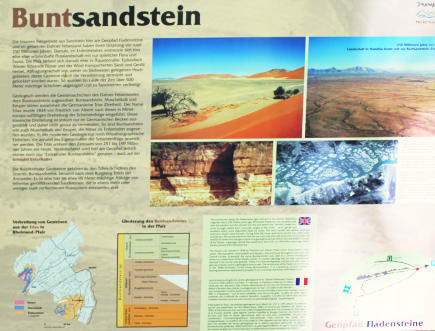
Die Gestaltung der Tafel, wurde von Landesamt für Geologie und
Bergbau, Rheinland Pfalz, Herr Roger Lang, durchgeführt.
Der Rundweg soll auch zum besseren Verständnis
der Landschaft und deren erdgeschichtliche
Vergangenheit beitragen.
Erlenbacher Turm
Am Fuße des Felsturms - Nordseite ist eine über drei Meter mächtige
Kieselschicht zu sehen, deren feine Kiesel zu einem Konglomerat
verfestigt sind. An der Südseite ist die Geröllschicht nur etwa 20 cm
stark, aber mit größeren Kiesel- und Geröllteilen durchsetzt. Die darüber
liegende etwa 1m mächtige Sandschicht zeigt zwar eine grobe Körnung,
aber nur wenige Kieseleinschlüsse. Nach oben wird die Sandkornschicht
über 2 m mächtig, bevor wieder eine, wenn auch dünnere, Geröllschicht
folgt. Die Verwitterung lässt durch mineralische Zusammensetzung und
bedingte Wasserdurch lässigkeit Bänke, Leisten und Gesimse entstehen.
Klüfte, senkrecht oder schräg verlaufende Spalten (Lassen), tonhaltige
Schichten mit Hohlkehlen, Höhlen, netzartiges Maschenwerk,
Felsabbrüche und Absanden sind Formen der Verwitterung, die an
verschiedenen Felsen zu erkennen sind.
Jüngstturm
Dieser Felsenturm verweist auf den Jüngstberg und die Sage von den
sieben feindlichen Brüdern, die in Felsengebilde verwandelt wurden.
Hier ist die Verwitterung durch Klüf te ohne Durchbruch sichtbar. Die
Klüfte entstanden durch tektonische Vorgänge (Zug, Druck, Torsion) bei
der Entstehung des Rheingrabens. Damals wurde die Buntsandsteinplat
te in Längs- und Querrichtungen zerstückelt und durch Verwerfungen in
verschiedene Höhen gebracht. An diesem Felsturm liegen an der Süd-
wand die rechten Abschnitte in Ostschräglage. An anderen Felsen
können die Lagen völlig gekippt sein. An den Klüften konnte die
Verwitterung besonders energisch einsetzen und sie zu klaffenden
Spalten erweitern.
Im Mittelbereich des Felsens sind deutliche Abbruchstellen an der
Schrägkluft zu erkennen. Die Netzbildung und die glatten Absandflächen
liegen unter der Fladenstruktur.
Stuhl
Dieser, vom Felsenriff bereits losgelöste Turm, hat seinen Namen durch
seine Form erhalten. Er zeigt an seiner Ostfront in etwa 1,50 m Höhe ein
weiß-strohgelbes Farbband, das durch aufsteigende Kohlenwasserstoffe
und deren Dämpfe aus dem Erdinnern entstanden ist. Die Eisenoxide im
Gestein ergeben die rote Farbe und erzeugen so eine Buntheit im Fels.
Dies führte zur der Namensgebung "Buntsandstein". Hier ist auch die feine
Geröllschicht unterhalb der weißen Feinplattenschicht zu erkennen. Die
Nordseite bietet in gleicher Höhe ein wunderschönes Schmuckfries.
Die Ausbleichung ist am Haardt-Rand noch deutlicher zu sehen, wo gelb-
weißer Fels durch Ausbleichung während des Grabenbruchs entstanden ist.
Am "Krimhildenstuhl" ließen die Römer bereits Ziersteine, Opfersteine und
Sarkophage brechen.
Namenloser Turm
An diesem Felsenturm sind die Fladen (flache Sandsteinplatten) am besten zu
erkennen. Diese Fladen gaben der Felsengruppe ihren Namen. Zwischen den
Platten sind rundzellige, hohlkugelförmige, netz- oder gitterförmige
Verwitterungen zu erkennen. An den Schichtfugen stehen zierliche Säulengänge.
In Augenhöhe sind an der Südwand "Kiesellöcher" und "Lösephasen" der Kiesel zu
erkennen. Hier wird auch die Zerstörung der Felsstruktur durch Organismen und
Pflanzen deutlich. Der feingraue Überzug aus Flechten saugt das Wasser auf, hält
es kurzzeitig fest und scheidet mit dem Überschuss auch chemische Stoffe aus,
welche die Unterlage zerstören. Auch Moose, Gräser, Sträucher und Bäume
dringen in die weicheren Schichtfugen ein, zersetzen oder sprengen Felsteile ab.
So können dann die Erosionskräfte die Verwitterung beschleunigt fortsetzen.
Bundenthaler Turm (Brocken)
Dieser größte zusammenhängende Felsklotz der Fladens teine hat sicher seinen Namen
durch das Dorf Bundenthal erhalten. Das BunteTal-oder"ValleColoris" - wie es 1290
genannt wurde, hat wahrscheinlich den Namen von den Buntsandsteinen, die hier das
Wieslautertal einschnüren und prägen. Der Fels zeigt eine glatte Westwand mit
wechselnd querver-laufenden Sandsteinstrukturen. Diese Wand stellt eine frühere
Abrutschfläche von Felsteilen dar. Die Westwind Wetterlage polierte sie glatt.
Der unterhalb der Wand erkennbare Felsklotz zeigt Strukturen, wie sie beim
Deckgebirge anzutreffen sind. An der Südwand kam es 1935 durch Blitzeinschlag zu
einem mächtigen Felsabsturz, dessen Trümmer noch am Fuße des Felsens zu sehen sind.
Durch Frostsprengung kommt es meist im März zu Felsabstürzen, wenn das in die
Spalten eingedrungene, gefrorene Wasser auftaut. Oberhalb der glatten Abbruchstelle
sind dunkle, teils schwarz gefärbte Flächen zu sehen, die sich blätterteigartig
aufwölben und ablösen. Es sind Verwitterungsrinden. Sie entstehen durch Sickerwasser
aus dem Gesims darüber, das mit Eisenmanganverbindungen angereichert ist. Diese
Platten wirken kurzzeitig als Schutzrinde. Kann das Wasser oder andere Erosionskräfte
die Rinde aufbrechen und darunter eine feuchte Höhlung schaffen, verliert die Platte
ihren Halt, löst sich lappenartig ab und legt das zermürbte Gestein frei. Die so gelöste
Felsstruktur kann dann leicht von Wind und Regen fortgeführt werden. So entstehen
immer neue Absandflächen, deren gelöste Sand- oder Geröllteile an der Felssohle zu
sehen sind. Ähnliche Verwitterung bewirken Organismen und Pflanzen. Im oberen Teil
der Südwand sind feine bis starke Lochgitterflächen in verschiedener Verwitterungsform
zu sehen. Die Färbung wechselt von unten nach oben, von dunkelbraun-strohgelb bis zu
fleischroten Tönen.
Hexturm (Ilex Turm)
Seinen Namen erhielt dieser Felsturm von der hier reichlich
vorkommenden Stechpalme "Ilex aquifolium", die seit 1910 unter
Schutz steht und deren Bäume bis zu 6 m hoch werden können. Heute
sind Ilex-Sträucher und -Bäume auf der Nordseite des Bundenthaler-
Turms noch anzutreffen und werden dort auch gepflegt. Die Ostfront
zeigt drei schöne weiße Schichtstreifen und typische
Verwitterungseinflüsse durch pflanzliche Organismen. An der Südwand
ist deutliche Wasserrinnen-Bildung durch Pflanzenwuchs (Birke) zu
sehen. Außerdem zeigt ein klotzförmiges, spitzzulaufendes
Felsteildeutliche Abbruchstellen an der Steilwand.
Bundenthal und die Fladensteinen
und tonigen Binde mitteln eine feste Sandsteinplatte.
Diese Platte wurde im Tertiär infolge Verschiebung
der Erdkruste und durch Absenkung des Rheingrabens
auseinandergebrochen und aufgewölbt. Die härteren
Schichten blieben erhalten und stellten, wie hier die
Fladensteine, ein lang gezogenes, jetzt bereits stark
aufgelöstes Felsenriff dar. Die Fladensteine gehören
zur Trifels-Stufe mit eisenoxidhaltigen,
ausgebleichten, grobkörnigen und geröllführenden
Schichten.
Ausgangspunkt der Wanderung ist der Sportplatz,
von hier können Sie direkt zu dem geologischen
Lehrpfad an den Fladensteinen wandern. Die
Fladensteine gehören zum Mittleren- oder
Hauptbuntsandstein, der im Trias vor etwa 230
Millionen Jahren entstanden ist. Die Sedimente des
Buntsandsteins- Quarzsande und Geröll wurden
durch Wind und fließendes Wasser abgesetzt.
Während der folgenden Juraperiode bedeckte ein
tiefes Meer diese Schichten und presste in
Verbindung mit Kieselsäure





Backofen
Diese stark verwitterte und abgetragene Felsstruktur zeigt die typische
Höhlenbildung. Die oben aufliegende Schicht besteht aus härteren
Strukturen, lässt das Wasser schnell ablaufen, das die
darunterliegenden weicheren Schichten mitreißt. Langsam
durchsickerndes Wasser lassen in der entstandenen Kehle ständige
Feuchtigkeit entstehen, wodurch die weichen Schichten aufgelöst
werden. Die Aushöhlung besorgen noch Spaltenfrost und Winde.
An der Südwand ist eine waagrecht verlaufende Tonschicht mit
ausgiebigem Pflanzenwuchs (Moose, Farne, Gräser) zu erkennen. In der
Hohlkehle darunter liegt eine feine Netzstruktur mit querlaufenden
Stegen. Unterhalb der nächsten Schichtfuge ist eine feine
Wabenstruktur in Auffaltungsrichtung zu erkennen. Der volkskundlich
entstandene Name erinnert an die Brotbacköfen bei den
Bauernhäusern.



nach oben



Geologie zum Anfassen
Die Fladensteine gehören zu den bekanntesten
Sandstein-massiven des Pfälzer Waldes. Entstanden als
ein über 400m langes, zusammenhängendes
Felsmassiv, bildeten sich durch Bewegungen und
Verwitterungen in der Erdkruste, Klüfte zwischen den
Steinen. Der größte der im Volksmund als “Sieben-
Brüder” bezeichneten Sandsteintürme, misst 52 m
Wandhöhe.
Rund um das Felsmassiv der Fladensteine bei
Bundenthal führt der Geopfad in die Zeit vor 250
Millionen Jahren und noch weiter zurück in die
Erdgeschichte. Von der Entstehung der Gesteine, über
deren einheimische Vorkommen bis hin zu ihrer
Nutzung als unentbehrliche Rohstoffe finden sich
anschaulich präsentierte Infos auf dem etwa
einstündigen Rundweg.
Start/Ziel: Bundenthal am Sportplatz.
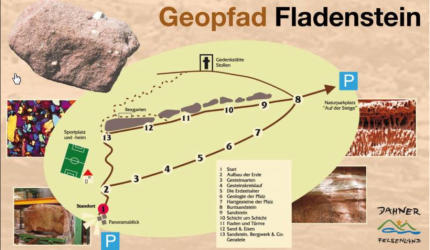
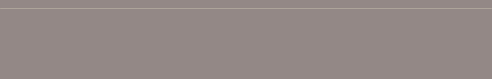

Bundenthal Touristik e.V., 76891 Bundenthal - Rechtenbacher Str. 29